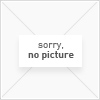Selbstfürsorge beginnt oft dort, wo niemand hinsieht: in der Küche. Zwischen Herd und Gewürzregal entfaltet sich leise die Kunst der Selbstliebe – ob allein, mit Familie oder im hektischen Berufsalltag. Ein Text über das Zubereiten als Zuwendung, über die Kraft einfacher Rituale und darüber, wie ein gedeckter Tisch die Einsamkeit durchbrechen kann.
Manchmal beginnt es mit einem Brotmesser. Es liegt da, still, auf dem Schneidebrett, neben einer Scheibe frisch angeschnittenem Sauerteigbrot. Der Tag war laut, chaotisch, vielleicht zu viel von allem. Und doch ist dieser Moment da. Ein Atemzug, ein Blick auf den dampfenden Tee daneben, der leichte Geruch von Thymian aus der Pfanne. Es ist nichts Großes. Und doch: Es ist Selbstliebe.
Selbstliebe hat viele Gesichter. Für manche bedeutet sie Yoga am Morgen, für andere das bewusste Nein im Berufsalltag. Aber oft beginnt sie viel unspektakulärer – in der Küche. Zwischen einer Schale Haferflocken und dem Klang von laufendem Wasser an der Spüle. In der Entscheidung, sich selbst etwas zuzubereiten, sich Zeit zu nehmen, sich zuzuwenden. Auch – oder gerade – wenn man allein ist.
In einer Zeit, in der der Alltag von Tempo und To-do-Listen geprägt ist, wird Selbstfürsorge zur Gegenbewegung. Die Küche ist dabei ein unterschätzter Ort. Sie ist mehr als Raum zum Funktionieren. Sie ist Rückzugsort. Bühne. Resonanzraum. In Familien ist sie oft der Ort der Begegnung, in Single-Haushalten der Ort der Entscheidung: Bin ich es mir wert, für mich selbst zu kochen? Zu decken? Zu würzen?
Besonders Menschen, die allein leben – ob gewollt oder nicht – erleben die Küche häufig als Spiegel. Einsamkeit zeigt sich nicht nur im leeren Stuhl gegenüber, sondern in der Frage: Wofür lohnt es sich, die Pfanne anzuheizen? Die Antwort: für dich. Gerade dann. Denn wer sich selbst Aufmerksamkeit schenkt, beginnt, sich selbst ernst zu nehmen. Und das Kochen wird zur Form der Zuwendung, des Sich-Annehmens.
Viele ältere Menschen, die allein leben, berichten von der Leere, die sich in der Küche breitmacht. Sie erzählen, wie sie früher für Familie, Partner, Freunde gekocht haben – und wie schwer es fällt, allein zu würzen, allein zu servieren, allein zu kauen. Aber gerade hier liegt der stille Schlüssel zu neuer Kraft: in kleinen Ritualen, liebevoll wieder eingeführt. Ein gedeckter Tisch – auch für eine Person. Das Lieblingsgeschirr. Musik aus vergangenen Jahrzehnten. Vielleicht ein Rezept, das an frühere Zeiten erinnert. Und manchmal, wenn der Tee dampft und der Butterduft sich ausbreitet, stellt sich für einen Augenblick Frieden ein.
Auch junge Menschen, frisch ausgezogen, in Ausbildung oder Studium, erleben die Küche oft als nüchternen Raum. Schnell wird gekocht, gegessen, gespült. Aber die Küche kann viel mehr sein – auch für sie. Ein Ort der Selbstermächtigung. Der erste selbstgebackene Kuchen, das erste selbst eingekochte Pesto. Vielleicht ein Abend allein mit Nudeln und Kerze. Oder ein Versuch, sich selbst ein Menü zu zaubern, um den eigenen Wert zu spüren – ganz ohne Likes oder Bestätigung von außen.
Wer in WGs lebt, erlebt Küche oft als Durchgangsstation. Hier trifft sich Alltag, Unordnung, Geräusch. Aber auch hier kann es Rückzugsorte geben. Eine Ecke nur für sich. Ein Fach im Kühlschrank, das nicht nur gefüllt ist, sondern Freude bringt. Ein Gewürzregal, das Geschichten erzählt. Oder der Moment, wenn man sich selbst eine heiße Suppe kocht, während um einen herum das Leben tobt.
Und dann sind da die Eltern. Mütter, Väter, Bonuseltern – in all ihren Rollen. Sie kochen oft nicht für sich, sondern für andere. Zwischen Stilltee und Brotdose verlieren viele ihr Gefühl für Hunger, für Genuss, für sich selbst. Doch gerade hier, im Trubel des Familienalltags, kann die Küche ein Ort der Achtsamkeit werden. Vielleicht bei der Zubereitung des Abendessens mit einem Glas Wein. Oder beim heimlichen Genießen eines Stücks Schokolade, wenn alle anderen schlafen. Oder indem man den Kindern zeigt: Essen ist mehr als Funktion. Es ist Fürsorge. Auch sich selbst gegenüber.
Und was ist mit den Menschen, die von Schichtarbeit, chronischer Erschöpfung, mentaler Belastung gezeichnet sind? Sie betreten die Küche oft müde. Aber auch hier kann sie heilsam sein. Ein Teller Suppe am frühen Morgen. Ein Brot mit Aufstrich um Mitternacht. Ein Licht über dem Herd, das bleibt, wenn alles andere dunkel ist. Diese Gesten erzählen: Du bist da. Du darfst müde sein. Aber du darfst auch satt und zufrieden sein.
Auch in Liebesbeziehungen zeigt sich Selbstliebe oft erst, wenn sie fehlt. Wenn einer immer kocht. Oder keiner mehr. Wenn gemeinsame Mahlzeiten zur Ausnahme werden. Oder zum Schlachtfeld. Die Küche ist Spiegel für Zuwendung – und für ihr Fehlen. Aber sie kann auch Wiederannäherung bedeuten. Gemeinsames Schnippeln. Gegenseitiges Füttern. Oder das stille Nebeneinander, in dem jeder für sich, aber nicht allein isst.
Und was ist mit denen, die sich nicht in klassischen Geschlechterrollen wiederfinden? Die queer leben, poly oder gar nicht festgelegt? Auch sie haben oft ihre ganz eigenen Kämpfe mit Küche, Essen, Sichtbarkeit. Aber auch hier gilt: Jeder Mensch hat ein Recht auf Wärme, Genuss und Versorgung. Ohne Scham. Ohne Klischee. Die Küche darf ein sicherer Ort sein – egal, wie man liebt, lebt oder kocht.
Manchmal reicht eine einzige Handlung, um all das zu aktivieren. Eine Schale Miso-Suppe. Ein liebevoll belegtes Brot. Ein Apfel, in Spalten geschnitten, mit Zimt bestreut. Die Dinge müssen nicht perfekt sein. Nur echt. Und liebevoll.
Selbstliebe in der Küche bedeutet auch, sich gegen Leistung zu entscheiden. Gegen Perfektion. Für Echtheit. Für Sinnlichkeit. Für Geduld mit sich selbst. Für ein Essen, das nicht beeindrucken, sondern nähren soll.
Und wenn es Tage gibt, an denen man nicht mag? Dann ist auch das okay. Vielleicht ist Selbstliebe dann: sich etwas bringen lassen. Oder aus der Packung essen. Aber vielleicht mit einer Serviette. Oder einem echten Glas. Und vielleicht, wenn man Glück hat, erinnert man sich irgendwann wieder: Ich bin es wert. Ich darf mich nähren.
Denn die Küche ist nicht nur Herd und Spüle. Sie ist auch Schutzraum. Sinnbild. Spiegel. Und manchmal – wenn alles stimmt – wird sie zu einem Ort, an dem nicht nur gekocht, sondern gelebt wird. Ein Ort, an dem Einsamkeit leiser wird, weil man sich selbst Gesellschaft leistet. Ein Ort, an dem Achtsamkeit nicht aufwendig, sondern selbstverständlich ist. Und ein Ort, an dem Selbstliebe ihren Platz findet – zwischen Löffel, Licht und leiser Musik.
Du darfst sein. Du darfst satt sein. Du darfst lieben – auch dich selbst. Heute. Morgen. Immer.